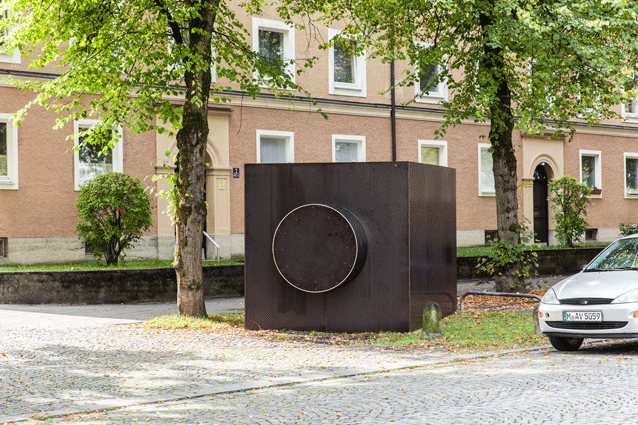aktuell cv arbeiten texte home
Von der Würde der Opfer und vom schwierigen Umgang mit dem Gedenken
I.
Eine schwarze Box steht in der Weißenseestraße in München-Giesing, keine Namen, keine Bilder. Im heutigen Gebäudekomplex mit den Hausnummern 7–15, dem damaligen Außenlager des Agfa-Kamerawerk des KZ Dachau, waren zwischen 1944–45 um die 500 Zwangsarbeiterinnen verschiedener Nationalitäten interniert. Wenn wir das hören, wollen wir reflexartig mehr wissen. Wer waren diese Frauen, wie sahen sie aus? Wo und wie kamen sie her, wie haben sie gelebt, was haben sie erlebt und erlitten? Was war der Hintergrund ihrer Gefangennahme? Wir wollen, so meinen wir, ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem wir ihre persönliche Geschichte und von ihrem Schicksal erzählen. Aber die Skulptur vor dem unscheinbaren Wohnhaus und ehemaligen Außenlager, diese „temporäre Gedenkstätte“ KAMERA des Künstlers Alexander Steig gibt den Frauen kein Gesicht, keinen Namen, wie Gedenkstätten es sonst oft machen. Das irritiert, und macht uns – wie immer, wenn etwas nicht so ist, wie wir es erwarten – aufmerksam auf unsere Gepflogenheiten. Warum werden die persönlichen Geschichten der Menschen, die hier gelitten haben, verschweigen, warum dürfen wir sie nicht kennenlernen?[1] Das erst kürzlich in München eröffnete Denkmal für die Opfer des Terroranschlages bei den Olympischen Sommerspielen 1972 arbeitet anders: Es erzählt die persönlichen Geschichten der israelischen Olympioniken, die damals ihr Leben verloren. Ihre Namen sind auf zwölf Tafeln groß angeschrieben, ihre Gesichter sind zu sehen und ihre Lebensläufe zu lesen. Die Stimmen der Presse begrüßen das Denkmal: Nun könne man die Opfer als Menschen kennenlernen.
Wir empfinden eine gewisse Genugtuung, an die getöteten, aber auch an die überlebenden, erst nach ihrer leidvollen Entrechtung verstorbenen Opfer, zu gedenken, indem wir über sie erzählen und sie dadurch vermeintlich der Anonymität entreißen. Wir sagen, sie sollen nicht vergessen werden. Dem Vergessen anheim zu fallen, das ist für uns Lebende die vielleicht schrecklichste Vorstellung von dem, was uns als Toten geschehen mag. Aber ich möchte einmal anders fragen – und es ist vielleicht eine schwierige, vielleicht eine gefährliche Frage: Woher nehmen wir die Überzeugung, die solche Angst nährt? Ist es für Verstorbene wirklich schrecklich, von der Welt vergessen zu werden? Könnte es nicht auch erlösend sein, gänzlich aus der Welt zu verschwinden, also auch aus den Erinnerungen? Hier kann sich ein leises Unbehagen regen, so leise, dass wir es kaum hören oder spüren. Von diesem Unbehagen zu reden ist schwierig, ohne Missverständnisse zu erregen. Allzu stark aufgeladen sind die Begriffe des Vergessens und des Erinnerns und zu sehr verschränkt und verwoben mit Urteilen, Werten, moralischen Maximen – insbesondere im Umgang mit Opfern politischer und völkerrechtlicher Verbrechen gerade auch des NS-Regimes. Der Umgang der Lebenden mit den Toten ist durchzogen von kulturellen Konventionen und Gepflogenheiten. Trotzdem will ich hier davon zu sprechen versuchen, von dem leisen Unbehagen vor allem, das aus der Frage rührt, ob die Toten von uns erinnert werden wollen. Oder man kann auch anders fragen: Ob wir mit den Menschen posthum machen dürfen, was wir wollen. Haben Tote einen Anspruch auf Privatsphäre?
II.
Als meine Großmutter gestorben war, traf sich die ganze Familie in ihrem Haus, um ihren Nachlass aufzulösen. Ich erinnere mich an das Gefühl, als wir in das Haus eintraten: Die räumliche Ordnung aus ihren Lebzeiten war verschwunden. Es gab keine Grenzen, keine Schwellen mehr. Wir liefen wie getrieben durch alle Zimmer, öffneten Schränke und Schubladen und durchwühlten ihre Sachen bis in die bisher verschlossensten Winkel. Ich spürte, wie wir ein feines Netz zerstörten, das das Leben meiner Großmutter in dieses Haus gesponnen hatte. Und ich spürte auch eine voyeuristische Lust, mich ungehindert überall umschauen zu dürfen und in eine bisher geheime Sphäre meiner Großmutter einzudringen. Die meisten Schubladen und Schränke waren zu ihren Lebzeiten für uns nie geöffnet worden, selbst einige Räume hatte ich nie betreten. Aber jetzt, plötzlich war alles offen! Oft erinnere ich mich an den Gang durch ihr Haus, wenn ich in Wohnräumen verstorbener Dichter herumwandle, die zu Museen umgewandelt worden sind. Warum genieren wir uns nicht, in die letzten Ecken von Goethes Wohnhaus zu spitzen, oder die Liebesbriefe an seine Frau zu lesen?Meine Großmutter war keine berühmte Dichterin, sie war auch kein Opfer eines politischen Verbrechens. Wer in ihrem Haus stöberte, in ihren privaten Sachen, das waren wir, ihre Familie. Hier existierten noch Schwellen. Die Öffentlichkeit hatte kein Recht, Einsicht in ihr Leben zu erhalten – und sicherlich hätte die Öffentlichkeit auch eher geringes Interesse daran. Aber ist sie nur durch den geringen Grad des Interesses geschützt? Worum geht es im Umgang mit Toten – um Gerechtigkeit oder um Interesse? Was für eine und wessen Gerechtigkeit und was für ein und wessen Interesse oder Bedürfnis ist es, die Privatsphäre der Toten aufzubrechen? Wem wird eigentlich wer oder was gerecht? Das Recht der Lebenden speist sich vor allem aus der physischen Schwäche der Toten. Wir können ungehindert in ihre privaten Angelegenheiten eintauchen, in ihren Briefen und in ihren Tagebüchern lesen – die Debatte um Franz Kafkas unveröffentlichten Nachlass ist nur das bekannteste Beispiel aus zahllosen Diskussionen um den Umgang mit zu Lebzeiten unveröffentlichtem Material verstorbener Persönlichkeiten.
Die Fragen, die wir hier anrühren, werden sehr schnell sehr, sehr groß. Wir wollen versuchen, sie klein zu halten und bei der Installation KAMERA zu bleiben. Die KAMERA ist ein Kasten mit Zylinder, der durch das Objektiv einer Fotokamera inspiriert worden ist. Eine KAMERA OBSKURA könnte man in Abwandlung zur Camera obscura – die sie auch ist – sagen. Es ist tatsächlich aber vor allem eine obskure Kammer, die Dunkelheit einschließt und keinen Einblick gewährt. Was sie enthält, kann niemand sehen. Bricht man sie auf, liegt das, was in ihr ist, nicht mehr im Dunkeln, und das Dunkel selbst zerreißt. Die Kammer ist aufgelöst, wenn wir in sie hineinsehen.
III.
Wir haben uns daran gewöhnt zu denken, dass es ein allgemeines Bedürfnis ist, berühmt zu werden. Daher gehen wir auch mit den Toten so um. Wir zeigen, wie sie aussahen, wir nennen ihre Namen und erzählen von ihrem Leben, von ihrem Sterben, von ihren Leiden. Woher kommt die Idee, dass es ein Wunsch 'des Menschen' sei, berühmt zu werden? Erst kürzlich stieß ich auf eine alte Zeichnung des französischen Cartoonisten Jean-Jacques Sempé, in der aus einer Wolke eine Hand auf einen Mann auf der Straße herunterzeigt und in großen Lettern eine Stimme aus dem Himmel donnert: „Du kommst nie ins Fernsehen“. Es ist wie eine schreckliche Verdammnis, die da aus dem Himmel fährt – und zugleich erfasst die Zeichnung eine bestimmte Mentalität aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, die in der unbestimmten Sehnsucht, einmal ins Fernsehen zu kommen, einen merkwürdig prägnanten Ausdruck findet.Die Anonymität war für den Durchschnittsmenschen vor dem Aufkommen der Massenmedien der Normalfall. Aber im 20. Jahrhundert änderte sich etwas; die Vision, dass jeder in der Zeitung, im Radio oder im Fernsehen auftreten könnte, elektrisierte das damalige Weltbild. 1968 verkündete Andy Warhol: „In the future everyone will be world famous for 15 minutes“. Aber es lohnt sich, Warhols häufig zitierten Satz einmal ein bisschen länger durchzukauen. Was ist das für Ruhm, der nur 15 Minuten lang währt? Haben wir Ruhm nicht immer als eine Art Unsterblichkeit gedacht? Aber wie kann man nur 15 Minuten lang unsterblich sein?
Ja, Ruhm hat etwas mit Unsterblichkeit zu tun. Aber von den Massenmedien her haben wir die Lebenswirklichkeit neu sortiert. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts gingen wir sogar soweit zu behaupten, dass etwas, was nicht in den Kommunikationsmedien zirkuliere, gar nicht existiere. Seit der zunehmenden Nutzung digitaler und sozialer Medien im Internet hat sich etwas verändert. Und auch der Klang von Warhols Satz hallt in einer anderen Tonlage wider. Die Sorge um Datenschutz und Verletzung der Privatsphäre überlagert zunehmend die Sehnsucht nach Berühmtheit. Bekannt zu werden, ist zweifelhaft geworden. Aber zunächst sind wir noch verunsichert, was das für unsere Lebensziele und unsere Lebensführung bedeutet. Vor allem auch dafür, was und wie viel von uns wir einst hinterlassen wollen.
IV.
Vor zehn Jahren, im Jahr 2009, erschien in einer Ausgabe des französischen Print-Magazins Le Tigre ein Porträt eines jungen Mannes namens Michel: Der Verfasser gratulierte Michel zuerst zum Geburtstag und fuhr fort: "Wir dürfen doch du sagen, Michel, nicht wahr? Gewiss, du kennst uns nicht. Aber wir wissen sehr viel über dich. Du bist heterosexuell und Single. Im Frühjahr 2008 hattest du eine Geschichte mit Claudia (...)"[2] Zu sehen waren auch Bilder: eine Umarmung am 31. Mai und Händchenhalten am 22. Juni. Der 29-jährige Michel empörte sich über die indiskreten Veröffentlichungen von intimen Details aus seinem Privatleben und klagte gegen Le Tigre. Die Redaktion aber entgegnete, sie habe alle Angaben ohne Aufwand im Internet gefunden und lediglich für ihre Printausgabe zusammengestellt. Alles, was Le Tigre gedruckt hatte, war von Michel selbst auf Youtube, Facebook oder Flickr veröffentlicht worden. Doch erst durch den gedruckten Artikel wurde ihm klar, wie viel er von sich preisgegeben hatte. Diese Aktion hatte einen medienpädagogischen Hintergrund. Le Tigre veröffentlichte in einer Rubrik "Das Google-Porträt" zahlreiche Leserporträts mit sehr privaten Details, die sie alle mit wenigen Klicks gesammelt hatten. Es ging um das Bewusstsein im Umgang mit persönlichen Daten.Wir können, so glaube ich, die Empörung von Michel sehr gut verstehen, und wir halten die Veröffentlichung seines Privatlebens für eine unzulässige Indiskretion, auch wenn der Trick von Le Tigre die Sache ein wenig kompliziert macht. Aber denken wir noch einmal einen Schritt in eine andere Richtung: Stellen wir uns vor, Michel sei bei einem Unfall ums Leben gekommen oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Empfänden wir dann dieselben Schilderungen seines Lebens, denselben Text immer noch als unzulässige Indiskretion? Oder empfänden wir die Schilderung seines Lebens inklusive intimer Details als würdigen Nachruf?
V.
Jean-Paul Sartre malt sich – und uns – in seinem Drama Geschlossene Gesellschaft (Huis Clos, 1944 uraufgeführt) eine Szenerie aus, in der die Menschen nach ihrem Tode in der „Hölle“, in einem Zimmer, eingesperrt sind. Sie sind dazu verdammt, nur noch so zu sein, wie die Lebenden auf der Erde an sie erinnern. Sartre schreibt in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts: "Tot sein heißt den Lebenden ausgeliefert sein."[3] Es ist bemerkenswert, dass Sartre große Teile seines Denkens darauf aufbaut, dass den Verstorbenen daran gelegen sei, von den Lebenden erinnert zu werden. Und es ist erstaunlich, dass auch wir kaum Zweifel daran haben. Von Sartre her wird ein kulturelles Paradigma erkennbar: Eine gewisse abendländische Tradition der Erinnerungskultur glaubt daran, dass man den Toten Genugtuung und Gerechtigkeit widerfahren lässt, wenn man von ihnen so lange und so viel wie möglich erzählt. Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit spielt hier auch eine Rolle. Die Vorstellung des unendlichen Fortlebens im Gedenken der Nachwelt hat besondere Bedeutung in der europäischen Antike und für die Neuzeit in der Renaissance. Es entsteht hier die Idee, durch große Taten berühmt und unsterblich zu werden. Tatsächlich spielt bei Sartres Stück noch die Vorstellung mit hinein, dass man, solange die Welt existiert, irgendwie zu ihr auch nach dem Ableben dazugehöre. Hier scheint die christliche Lehre vom Jüngsten Tage, an dem alles abgerechnet wird, was zum Weltenlauf gehörte, ein Echo zu haben. Denn werden nicht bis dahin also alle Toten irgendwie aufgehoben? Ein diffus archaischer Totenglaube spielt hier womöglich auch noch mit hinein... Womöglich aber geht es gar nicht um das Leben nach dem Tode, sondern um die Frage nach dem Umgang mit Leben und Tod im Leben!VI.
Malen wir doch mal ein ganz anderes Bild: Stellen wir uns vor, wir seien gestorben, und wir wären froh, dass wir erlöst vom Leben wären und mit dem ganzen irdischen Dasein endlich nichts mehr zu tun hätten. Wir sind vielleicht auch andere Wesen, wir haben möglicherweise neue Aufgaben, und unser früheres Leben interessiert uns nicht mehr – wir können uns auch etwas Anderes vorstellen, die Visionen und Ideen sind ja hier zahl- und variantenreich. Im Kern geht es darum, dass wir für die folgenden Überlegungen annehmen wollen, dass der Tod uns vom Leben angenehm löse und dass die Erinnerung der Lebenden auf der Erde uns störe.Wir können das schon als Lebende leicht empfinden, glaube ich: Wir wollen ja auch im Leben gar nicht immer und so ohne weiteres an das ganze Leben angeschlossen sein. Wir wollen nicht, dass die Öffentlichkeit alles Mögliche von uns erfährt. Ja, eigentlich wollen wir gar nicht alle ins Fernsehen, und wir wollen auch gar nicht alle berühmt werden. Vielleicht wollen wir auch gar nicht alle, dass sich jemand an uns erinnert? (Und wahrscheinlich war das schon immer so, auch in den hysterischen Medienhypezeiten des 20. Jahrhunderts). Stellen wir uns nun noch weiter vor, dass wir einem politischen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, und nun erhalten wir ein Denkmal, Bücher werden über uns geschrieben usw. Unter den Lebenden darf nun jeder erfahren, wer wir waren, was wir gemacht haben, wie wir gelebt haben – wie über den 29-jährigen Michel. Und jeder darf erfahren, wie wir gelitten haben, wie wir umgekommen sind –, vielleicht war es ein sehr erniedrigender Leidensweg, ein unwürdiger Tod, ein Mord? Wäre das wirklich Trost oder Genugtuung?
Was Tote mögen oder nicht mögen, ob sie überhaupt etwas mögen können, das wissen wir nicht. Aber wie dürfen wir mit den Verstorbenen umgehen? Warum sind Menschen plötzlich berührbar und verfügbar, wenn sie tot sind, in besonderem Maße, wenn sie Opfer von politischer Gewalt geworden sind?
Aber jetzt wird es schwierig. Wenn wir jetzt sagen: Rühren wir sie nicht an, sie haben ein Recht auf Ruhe, das klingt wie „die Vergangenheit soll ruhen.“ Wahrscheinlich ist da auch etwas richtig. Es klingt nicht nur falsch, es klingt auch nach Frieden, eine ruhende Vergangenheit. Aber stimmig ist es nur, wenn die Vergangenheit echten Frieden gefunden hat. Öfter indes hören und sagen wir den Satz gerade da, wo sie eben nicht zur Ruhe kommt und keinen Frieden findet. Der Satz meint oft: die Vergangenheit soll Ruhe geben! Gerade dort, wo sie es nicht tut, wo sie beunruhigt. Gemeint ist eigentlich: Unsere Beunruhigung soll aufhören! Es kann nicht darum gehen, Verbrechen und Unrecht tot zu schweigen. Aber es darf nicht um den Preis der Würde der Toten geschehen, dass man von den Verbrechen spricht – was aber wiederum keinesfalls heissen kann, dass man von den Opfern nicht sprechen soll! So einfach ist es nicht.
Es geht am Ende – oder vielleicht ist es auch der Anfang – um unser Leben, um etwas, was man auch Seelenheil nennen kann, bei dem Umgang mit den Toten und bei dem Umgang mit Verbrechen in der Vergangenheit, und auch beim Umgang mit Verbrechen in der Gegenwart, und beim Umgang mit Toten in der Gegenwart. Und da sollten wir nicht leichtfertig und zu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Daher müssen wir noch eine Wendung machen.
VII.
Der Münsteraner Zoologe, Verhaltensbiologe und Theologe Rainer Hagencord, der sich viel mit Fragen der Ethik im Umgang mit den Tieren beschäftigt hat, erzählte 2016 in der Sendereihe "Zwischentöne" im Deutschlandfunk,[4] als Priester machte er im Gottesdienst die Würde der Tiere immer wieder zum Thema. Eine Landwirtin habe ihm eines Tages gesagt: „Wissen Sie, wenn ich mit dem Wort ‚meine Schweine haben eine Würde‘ in den Stall gehe, kann ich meine Arbeit nicht machen – aber ich muss sie machen.“[5] Wir kennen alle diese Geste, die sich auf die Lebensumstände und die Notwendigkeit des Lebens beruft. Hagencord erklärte in dem Radiogespräch, hier werde deutlich, dass eine Art der Tierhaltung, in der Tiere reduziert würden zu Rohstoffen, auch an der Seele des Menschen nicht vorübergehe, und letztlich zu einer Verrohung führe. Der Umgang mit dem Tier frage die Seele an, das animal, so Hagencord, zeige sich in der anima.Von hier eröffnet sich ein neuer Aspekt auf unser Thema: In welcher Weise fragt unser Umgang mit den Verstorbenen unsere Seele an? Und sind sie für uns nicht auch oft Rohstoff? – in Auseinandersetzungen um Schuld und Sühne, in politischen Machtkämpfen, in Werken der Erinnerung, Denkmälern, politischen Debatten? Oder auch in der Kunst? Der öffentliche Kunstdiskurs spendet gegenwärtig solchen Arbeiten eine besondere Aufmerksamkeit, die ihre Relevanz aus Unrecht, Verbrechen, politischen Themen oder humanitären Notlagen zu beziehen versuchen. Die Kunst kann aber auch ein Ort sein, an dem offen nachgedacht wird, Bilder ausprobiert werden. Man kann in der Kunst nachdenken, und auch vordenken, und Formen des Erinnerns erproben. Die künstlerische, ästhetische Arbeit ist immer in eine Ethik verschlungen und besitzt zugleich eine andere Sphäre. Die Frage der Würde, die Hagencord aufgeworfen hat, weist vielleicht einen Weg zurück zur Skulptur KAMERA von Alexander Steig. Seit einiger Zeit reden wir von der Würde der Tiere, von der Würde der Pflanzen, vom Respekt gegenüber der Natur.[6] Es leuchtet ein, es ist gut und richtig. Nicht nur als Engagement, auch für unser Empfinden, unsere Seele.
VIII.
Ich hatte ja eingangs gesagt, wie schwierig es werden würde, und dass ich es trotzdem versuchen will, hier davon zu sprechen zu versuchen, von dem leisen Zweifel, ob die Toten von uns erinnert werden wollen, ob wir überhaupt wissen, was die Toten wollen, ob wir mit den Toten machen dürfen, was wir wollen bzw. was wir für richtig halten? Vielleicht ist mir der Versuch in vielerlei Hinsicht misslungen. Aber wir haben eine Frage dazugewonnen: Welche Würde kommt den Toten zu, insbesondere Opfern von Verbrechen, selbst wenn einige, wie im Falle der Zwangsarbeiterinnen des Außenlagers Agfa-Kamerawerk, ihre Internierung überlebt haben? Dürfen wir alle Netze zerreißen und in das intimste Privatleben eindringen, wenn Menschen Opfer eines politischen Verbrechens geworden sind. Ist es gerecht, alles ans Licht zu zerren, so dass wir alles Mögliche über diese Menschen erfahren? Es mag anrührend sein, die Geschichten dieser Menschen zu lesen und zu hören, und es mag sich gut und erbaulich anfühlen. Aber dürfen wir das Leben von Toten zur Erbauung nutzen? Ich bin darin sehr unschlüssig. Einerseits ist es richtig und recht, die Geschichten zu erzählen. Aber wenn wir uns vorstellen, wir seien von einem verbrecherischen Regime versklavt und ermordet worden, würden wir wollen, dass alles Mögliche über unser Privatleben veröffentlicht würde? Oder aber umgekehrt, würden wir vergessen werden wollen? Beanspruchen die Toten, dass man ihre Erinnerung lebendig hält? Oder beanspruchen sie Ruhe, wäre es – um es überspitzt zu formulieren – nicht auch denkbar, es sei ein Recht der Toten, dass wir sie vergessen? Wir sind jetzt zu der Frage nach der Würde der Toten gelangt. Wie können wir mahnen, die Opfer von Verbrechen würdigen, und der Verbrechen gedenken, ohne dass wir eigentlich wissen, was den Toten gemäß ist? Wir müssen wahrscheinlich weiter fragen danach, was die Seele berührt.Die KAMERA ist eine Demutsgeste vor solchen Fragen. Und zugleich ist sie grob und kantig. Sie stellt sich mitten auf den Weg, und sagt nichts, was geschwätzig wäre. Dieser schwarze Kasten ist ein buchstäblicher Anhaltspunkt: Er steht hier sichtbar und zugleich verschlossen. Die KAMERA reißt die Toten nicht aus ihrer Ruhe, aber sie ruft unsere Aufmerksamkeit wach, und steht uns im Wege. Indem dieser schwarze Kasten selbst schweigt und außen schwarz und innen dunkel ist, hindert er uns daran, geschwätzig zu werden. Und: um Ruhe zu finden und in Würde und lebendiger Kraft die Taten der Vergangenheit anzuschauen, müssen wir zuerst einmal ruhig werden, müssen wir schauen und auch annehmen, was wir nicht begreifen, und dass wir das alles nicht fassen können.
[1] Diesen Fragen ging die von Alexander Steig angebotene vierteilige Veranstaltungsreihe im Giesinger Bahnhof nach.
[2] Zit. nach: Constantin Wißmann: Du stehst auf blonde Frauen, oder? Ein französisches Magazin klaut Biografien aus dem Internet und veröffentlicht sie. In: fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung Ausgabe 31, 2009. S. 13.
[3] Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Hamburg 1998, S. 934.
[4] Der Theologe und Verhaltensbiologe Rainer Hagencord im Gespräch mit Michael Langer. Deutschlandfunk, 04.09.2016. Sendungsseite: https://www.deutschlandfunk.de/musik-und-fragen-zur-person-der-theologe-und.1782.de.html?dram:article_id=362252, aufgerufen am 06.03.2019.
[5] Ebd.
[6] Vgl. etwa: Stefano Mancuso, Alessandra Viola: Die Intelligenz der Pflanzen, München 2015. Rainer Hagencord: Diesseits von Eden: verhaltensbiologische und theologische Argumente für eine neue Sicht der Tiere, Regensburg 2009.Simon Frisch
(Text aus: Alexander Steig - KAMERA, München, 2019 )